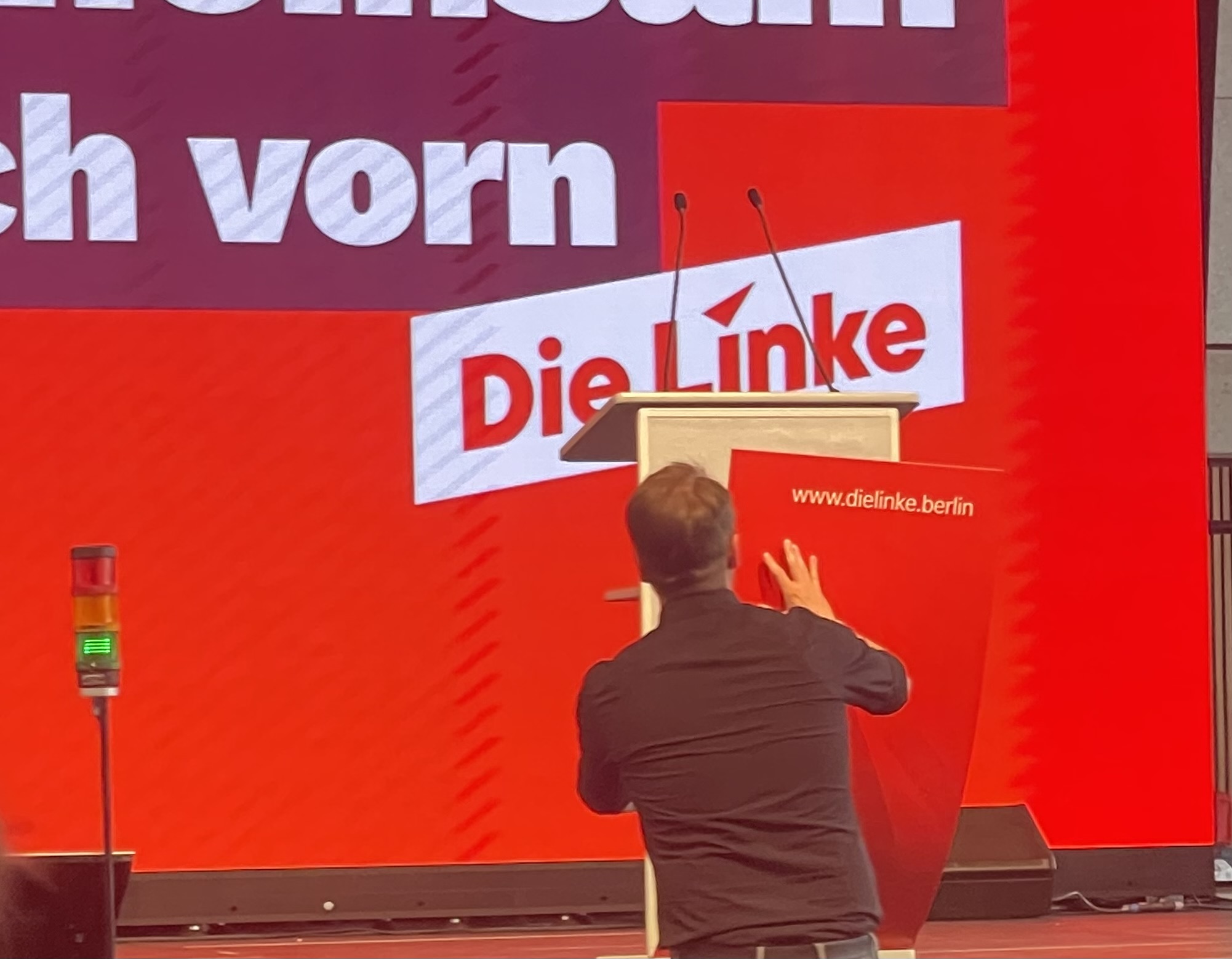Ob bei der Jerusalemer Erklärung oder bei der Frage von Regierungsbeteiligung in Berlin ab 2026 — der Berliner Landesparteitag war kein Ort für inhaltliche Festlegung, meint Carlos Quiñones.
Auf drei Ereignisse musste der zweitägige Landesparteitag der Berliner Linken am vergangenen Wochenende im Dong Xuan Center reagieren.1 Erstens stellte der dramatische Abgang von Lederer und Co. auf dem letzten Landesparteitag und ihr darauffolgender kollektiver Austritt — bei Beibehaltung ihrer Mandate im Abgeordnetenhaus (AGH) — die Delegierten vor das Problem, wie die Willkür von Mandatsträger:innen in Zukunft einzugrenzen und mit dem medialen Druck bei Kontroversen umzugehen sei. Zweitens konfrontierten die überraschenden Ergebnisse bei den Bundestagswahlen im Februar die Delegierten mit der Frage, wie sich Die Linke als stärkste Kraft in Berlin zur Frage der Regierungsbeteiligung auf Landesebene 2026 verhalten soll. Und drittens sollte der Berliner Landesparteitag das erste öffentliche Parteievent nach dem Bundesparteitag in Chemnitz sein, wo die breitere Partei vor den Augen der Medien über die Auslegung und Anwendung der neusten Parteitagsbeschlüsse— insbesondere der beschlossenen Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA) — streiten würde.
Eröffnung und Generaldebatte
Die Reden der ausgehenden Landesvorsitzenden der Berliner Linken Franziska Brychcy, des erneut kandidierenden Maximilian Schirmer sowie der eingeladenen Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner gaben den Ton an: Aus den Fehlern des vergangenen Landesparteitags habe man bereits gelernt. Es gab viel detailreiche Kritik an der schwarz-roten »Zerstörungskoalition«, die aber anscheinend nicht ausreichte, um die SPD als Koalitionspartner explizit auszuschließen. Zumindest wurde an der oppositionellen Sprache aus der Bundestagswahl festgehalten. Schirmer:
»Gucken wir nicht nur auf die nächste Wahl. Es geht uns nicht nur darum, ob es für diese oder jene Mehrheit reicht. Es geht uns darum, diese Stadt weiterzuentwickeln. Und wir wollen den Menschen das Gefühl geben, dass sie mit uns gemeinsam um diese Stadt kämpfen. Nicht die anderen Parteien sind der Bezugspunkt, sondern die Menschen in dieser Stadt.«
Kritik an der israelischen Regierung, an der Repression und auch an der Instrumentalisierung der Antisemitismusbekämpfung wird mittlerweile breit getragen. So war es der ausgehende Landesvorstand selbst, der einen Antrag gegen die politisch motivierte Ausweisung von vier Palästinaaktivist:innen vorlegte. Zugleich musste auffällig oft an die »Selbstverständlichkeit« erinnert werden, »dass wir unmissverständlich zum Existenzrecht Israels als Schutzraum für Jüdinnen und Juden stehen« (Brychcy und Schwerdtner), sowie daran, dass die »Zweistaatenlösung« Beschlusslage ist (Brychcy). Dies geschah sogar unter Einsatz einer persönlichen Stellungnahme im Anschluss an die Generaldebatte (anscheinend war die Botschaft nicht recht verstanden worden).
Abgesehen davon, dass es, wie UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese sagt, »im Völkerrecht so etwas wie das Existenzrecht von Staaten nicht gibt«,2 sieht die JDA eben schon die Möglichkeit vor, die nationale und individuelle Gleichberechtigung von Palästinenser:innen und Israelis höher zu werten als die deutsche Staatsräson. Die Diskussion um Definitionen ist also nicht trivial.
Wahlparteitag
Bei jeder Wahl kam es vor, dass entweder nur wenige oder, wie bei der Wahl der Landesvorsitzenden, überhaupt keine linken Gegenkandidaturen zur Auswahl standen. Doch die meisten Kandidat:innen, welche eine Regierungsbeteiligung überhaupt von Bedingungen abhängig machten oder wegen ihrer palästinasolidarischen Positionen bekannt sind, wurden auch gewählt.
Das regierungsfreundliche Lager ist nach den Austritten zwar nicht gerade selbstbewusst oder eigenständig aufgetreten. Doch dort, wo es darauf ankam, standen die Regierungslinken mit eigenen Kandidat:innen bereit, auch wenn diese mit ihren kontroverseren Positionen (mehr schlecht als recht) hinterm Berg hielten. Aus dieser Gemengelage ist ein Landesvorstand zustandekommen, der, vielleicht mit einer leichten Linksverschiebung, dem parteivorstandsnahen Zentrum gegenüber den Flügeln das Übergewicht gibt. Bei der Wahl der neuen Doppelspitze aus Maximilian Schirmer (61,9%) und Kerstin Wolter (71,9%) kam dennoch zum Vorschein, dass es bei vielen durchaus ein starkes Bedürfnis nach Alternativen gegeben hatte.
Beschlüsse
Der einstimmig angenommene Leitantrag weicht der strategischen Frage der Regierungsbeteiligung aus, und fokussiert sich stattdessen darauf, wie die mittlerweile über 15.000 Berliner Mitglieder effizient organisiert und in Bewegung gebracht werden können, um Die Linke als Opposition zum »sozialen Kahlschlag von CDU und SPD« in Stellung zu bringen. Hier sollen neben dem Ausbau der Parteistrukturen im engeren Sinn Initiativen wie Die Linke hilft, Mieter:innenorganisierung und die Unterstützung von Gewerkschaftskämpfen eine zentrale Rolle einnehmen. Zu den auf dem Parteitag getroffenen politischen Beschlüssen gehören — neben der bereits genannten Solidarität mit den von Ausweisung bedrohten Palästinaaktivist:innen — die Forderung nach einer Abschaffung des sogenannten Berliner Neutralitätsgesetzes (Stichwort: „Kopftuchverbot“), die Forderung nach einer Wiedereingliederung der Beschäftigten der Charité-Tochtergesellschaft Charité Facility Management (CFM) in die Charité (ein CFM-Arbeiter auf dem Parteitag erinnerte daran, dass die Teilprivatisierung 2006 unter Rot-Rot stattfand), Kritik an Kürzungen bei der Bildung und in den Kitas, Unterstützung für den Verkehrswendeentscheid, sowie die Forderung nach Vergünstigung und Ausweitung des Gültigkeitsbereichs des Sozialtickets „Berlin S“. Angesichts der vielen Neumitglieder wurde außerdem beschlossen, dass der Landesvorstand die Möglichkeit einer perspektivischen Neuwahl der Landesdelegierten bis zum nächsten Landesparteitag prüfen soll.
Vergesellschaftung als rote Haltelinie
Zwei Beschlüsse, die in Bezug auf die Abgeordnetenhauswahl 2026 von zentraler Bedeutung sein werden, sind einmal der Beschluss „Vergesellschaftung zur Chefinnensache machen“ der LAG Vergesellschaftung, der jede Regierungsbeteiligung von der Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen & Co. enteignen abhängig macht, und der Beschluss „Strategieprozess zur Regierungsbeteiligung Die Linke Berlin“ der Berliner Linksjugend. Der erste Beschluss ist vom Argument her so gestaltet, wie es für die Parteilinke seit eh und je üblich ist. Eine strategische Haltung wird gemieden, stattdessen werden taktische Ziele als rote Haltelinien formuliert: »Wenn wir in die Regierung gehen, wird der Volksentscheid umgesetzt«. Es ist natürlich begrüßenswert, dass der Antrag durchgekommen ist. Dass es aber überhaupt notwendig ist, immer wieder neue rote Haltelinien zu zeichnen, ist der Realität geschuldet, dass das Erfurter Programm diese Haltelinien nicht hergibt. Ben Lewis schrieb über den Text schon 2013:
»Das 30.000 Wörter umfassende Programm der Partei Die Linke ist ein Ausweichmanöver von epischem Ausmaß. Vage Plattitüden und Allgemeinplätze stehen an der Stelle von klarer Politik und Prinzipien. Der Parteilinken wird der eine oder andere „antikapitalistische“ Knochen zugeworfen, aber die Hauptfrage — unter welchen Bedingungen Die Linke in eine Regierung eintreten würde — wird bewusst, fleißig und zynisch umschifft.«3
Seitdem hat es die Parteilinke als Ganzes versäumt, in dieser Frage Klarheit zu schaffen. Stattdessen schwingt sie sich von einer roten Haltelinie zur nächsten.
Strategiedebatte rund um Regierungsbeteiligung
Der Jugendverband hob in seinem Antrag die positiven Erfahrungen der Linken in der Opposition und den Zusammenhang von Regierungsbeteiligung und der Zustimmung der linken Senator:innen im Bundesrat für Aufrüstung hervor. Die Kritik an den Regierungslinken in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern wurde gestrichen, dafür ist ein Strategieprozess zur Frage von Regierungsbeteiligung auf Landesebene beschlossen worden. Folgende Fragen sollen im Zentrum der Debatte stehen:
»Welche Vorteile für das Erreichen des Sozialismus bietet eine Regierungsbeteiligung oder opfert Die Linke damit das langfristige Ziel für kurzfristige Erfolge?
Wie kann durch Oppositionsarbeit die Partei den Kampf für den Sozialismus stärken?
Was ist die Strategie und das Ziel von der Arbeit im Abgeordnetenhaus? Was soll erreicht werden? Wie kann es erreicht werden und welche Risiken gibt es?
Wie wird sichergestellt, dass die Abgeordneten (und Senator*innen bzw. Bürgermeister*innen) im Interesse der Partei und des Kampfes für den Sozialismus agieren?«
Außerdem einigten wir uns darauf, dass es bis zum Abschluss der Debatte keine öffentliche Stimmungsmache für eine linke Regierung 2026 geben wird:
»Der Landesvorstand und die Linksfraktion im AGH, sowie weitere Mandatsträger:innen werden bis zum Abschluss dieser Strategiediskussion keine öffentliche Vorfestlegung auf eine Regierungsbeteiligung nach den Abgeordnetenhauswahlen 2026 treffen. Wir konzentrieren uns in den nächsten Monaten auf den gemeinsamen Kampf an der Seite von betroffenen Einrichtungen, Trägern und Beschäftigten gegen den Kahlschlag des CDU/SPD-Senats.«
- Der gesamte Parteitag wurde auf Youtube hochgeladen.
Der erste Tag: https://www.youtube.com/watch?v=vsBlwp7-nGk&t=6641s
Der zweite Tag: https://www.youtube.com/watch?v=rGqPvudfrPU ↩︎ - https://www.youtube.com/watch?v=k12E7LuD2_4 [Übersetzung] ↩︎
- https://weeklyworker.co.uk/worker/978/die-linke-rotten-politics-and-rotten-terms/ [Übersetzung] ↩︎