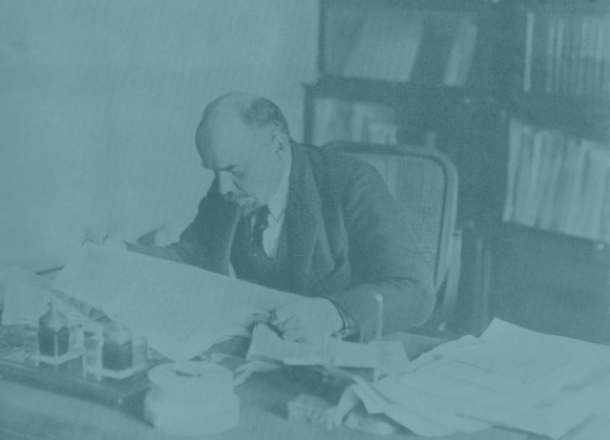Eine ungenaue Gegenüberstellung von Staat und Kapital führt zu einem falschen Bild sozialistischer Planung, argumentiert Lucien Diehl in seiner Antwort auf den Beitrag Kapitalismus als Förderung der Innovation?.
Die Legitimationserzählungen des Kapitals und der Herrschenden zu entkräften, die versuchen, die gegenwärtige Wirtschaftsweise als die einzig mögliche und diese Welt als die beste aller Welten zu verkaufen, ist eine zentrale Aufgabe für Kommunist:innen und alle, die daran arbeiten, die gegenwärtigen Verhältnisse grundlegend zu verändern. Der Artikel „Kapitalismus als Förderung der Innovation?“ tut genau das und zeigt sehr deutlich die Widersprüche der vorherrschenden Erzählung über die angeblichen Vorteile des Kapitalismus als Wirtschaftsmodell auf. Und obwohl es natürlich richtig ist, dass die Profitorientierung der Wirtschaft in direktem Widerspruch zu den Bedürfnissen der Menschen steht und die damit einhergehende Ressourcenallokation auf dem kapitalistischen Markt nicht im Interesse der Mehrheit der Gesellschaft erfolgt, scheint die Kritik des Artikels am Kern des Problems vorbeizugehen: Das Problem ist nicht so sehr, dass Kapitalist:innen Innovationen nutzen, die sie nicht hervorgebracht haben, sondern vielmehr, wer darüber entscheidet, was erforscht und produziert wird und vor allem wie. Um dieses Problem zu untersuchen, muss man sich also fragen, wer die Organisation und die Ziele von Forschung und Produktion bestimmt, und das bedeutet heute, das Zusammenspiel von Staat und Kapital zu analysieren. Trotz der Darstellung des Staates als Gesamtkapitalist am Ende des Artikels geht die gesamte Argumentation von einer recht starken und klaren Trennung zwischen Staat und Kapital aus. Auf der einen Seite gäbe es die Kapitalist:innen, die auf Profitmaximierung aus sind, auf der anderen Seite die „staatliche Forschung“, in der Grundlagenforschung betrieben wird. Auch wenn dies im Artikel nicht explizit erwähnt wird, scheint diese von der kapitalistischen Realität und ihren Zwängen abgekoppelt zu sein. Mit anderen Worten, es scheint hier eine Forschung um der Forschung willen zu geben, die dann aber vom Kapital kooptiert wird, um seine Profite zu maximieren. Meine Kritik wäre also erstens, dass diese Gegenüberstellung von Staat und Kapital einer Analyse der Bedingungen in der heutigen vermeintlich öffentlichen Forschung nicht standhält und uns zu den falschen Fragen führt, nämlich wie die vermeintlich öffentliche Forschung, die bereits stattfindet, für bessere Dinge genutzt werden kann. Und zweitens, dass diese Gegenüberstellung von Staat und Kapital und die Zentrierung des Staates als eigenständiger Akteur im Forschungs- und Innovationsprozess zu falschen Schlussfolgerungen führt, nämlich dass wir nur einen anderen, sozialistischen Staat bräuchten, der diese Forschung für bessere Dinge nutzt und die Ressourcen gerechter verteilt. Mit anderen Worten: Der Staat wird nicht nur in der Gegenwartsanalyse und -kritik als eigenständiger Akteur der (öffentlichen) Forschung und Innovation dargestellt, sondern auch im Lösungsvorschlag einer sozialistischen Planwirtschaft.
Zum ersten Punkt: Diese klare Trennung (trotz des Verweises auf den Staat als Gesamtkapitalisten) ist meines Erachtens nicht haltbar, weil sie den direkten Einfluss der Marktlogik und der Unternehmen selbst auf die Forschungsarbeit ausblendet. Es ist in der Tat fraglich, ob die heutige öffentliche Forschung tatsächlich „von der Gesellschaft getragen“ und „unter ganz anderen Prämissen als der Gewinnmaximierung betrieben“ wird. Natürlich kann der Staat aus Steuermitteln Forschung und damit Innovationen fördern. Staat und Gesellschaft dürfen aber nicht verwechselt oder gleichgesetzt werden: Auch in der „öffentlichen“ Forschung wird nicht gesellschaftlich entschieden, wie und was geforscht und wofür innoviert wird. Dies geschieht durch staatliche und öffentliche Institutionen jenseits demokratischer Entscheidungsprozesse und nicht selten unter erheblichem Einfluss privater Unternehmen. Tatsächlich mischen sich Unternehmen häufig in vermeintlich staatlich finanzierte Forschung ein, indem sie diese mitfinanzieren. Auf diese Weise können private Unternehmen erheblichen Einfluss darauf nehmen, welche Forschung vorangetrieben wird und welche nicht. Die zu strikte Trennung von Staat und Kapital verstellt aber auch den Blick auf den indirekten Einfluss kapitalistischer Zwänge auf die Forschungsarbeit und damit auf die wissenschaftlich-technische Innovation. So ist die Forschung an den Universitäten nach Jahrzehnten der Liberalisierung fast vollständig von der Logik des Marktes durchdrungen. Öffentliche Forschungseinrichtungen und der Staat selbst unterliegen letztlich ebenso dem Diktat des Marktes und der Profitlogik wie private Unternehmen, wenn auch auf andere Weise. Es ist zwar richtig, dass risikoreiche Grundlagenforschung eher nicht von privaten Unternehmen, sondern von öffentlichen Einrichtungen betrieben wird. Dennoch werden auch in diesen Einrichtungen immer weniger „riskante“ Forschungsprojekte finanziell unterstützt. Um eine Förderung zu erhalten, müssen die Forschenden häufig bereits im Förderantrag angeben, was bei der Forschung herauskommen wird. Das erschwert explorative und potenziell innovative Forschung erheblich – auch in öffentlichen Einrichtungen. Es geht also nicht nur darum, wer für wen forscht und wer Innovationen nutzt, sondern auch darum, wie geforscht wird und wer die Kontrolle darüber hat. Und wie und was geforscht wird, hängt auch in öffentlichen Einrichtungen wesentlich von ökonomischen Zwängen ab. Das heißt, die Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten der Forschenden hängen wesentlich davon ab, ob ihre Forschung kapitalistisch verwertbar ist. Aus diesem Grund würde ich behaupten, dass vermeintlich staatlich oder öffentlich finanzierte Forschung nicht von der allgemeinen Marktwirtschaft zu trennen ist. Und oft von vornherein im Interesse des Kapitals betrieben wird. Im Artikel wird auf Innovationen aus dem militärischen Bereich verwiesen, die dann als Innovationen von Privatunternehmen verkauft werden. Auch dies findet nicht außerhalb oder losgelöst vom kapitalistischen Markt statt, denn bürgerliche Staaten entwickeln ihre militärische Macht in der Regel, um sich in der kapitalistischen Konkurrenz behaupten zu können. Und auch die staatliche Infrastruktur, wie z.B. die Eisenbahnen, ist meist im Zuge der Entwicklung der kapitalistischen Industrie entstanden und wohl auch erst durch diese rasante Entwicklung der Produktivkräfte in diesem Ausmaß möglich und notwendig geworden. Die moderne Staatsform war von Anfang an mit der Entstehung des Kapitalismus verbunden und Voraussetzung für eine stabile Akkumulation.
Das Argument, der kapitalistische Markt führe oft zu „anarchischer“ Ressourcenzuweisung und sinnloser Ressourcenverschwendung, finde ich aber zutreffend. Das gleiche lässt sich aber oft von staatlichen und öffentlichen Institutionen sagen. Damit kommen wir zum zweiten Teil der Kritik. Die klare Gegenüberstellung von Staat und Kapital wird zwar durch den Hinweis auf die Rolle des Staates als Gesamtkapitalist differenziert. Daraus wird aber nicht das Problem des grundsätzlichen Zusammenhangs von kapitalistischer Produktionsweise und Staat (als von der Gesellschaft abgekoppeltem Akteur) abgeleitet und problematisiert, sondern die Schlussfolgerung gezogen, dass wir nur einen anderen, einen sozialistischen Staat brauchen. Doch auch die staatssozialistischen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts waren in den Weltmarkt integriert, und auch hier wurde nicht unbedingt im Interesse der Mehrheit produziert – wenn auch deutlich mehr als in der rein kapitalistischen Welt. Und leider gab es – aus anderen Gründen – auch in den sozialistischen Staaten Ressourcenverschwendung und fragwürdige Ressourcenallokation, z.B. aufgrund von Fehlplanungen, der Verlagerung von Planungs- und Entscheidungsbefugnissen in die Hände einer Staatsbürokratie und deren Abtrennung vom Rest der Gesellschaft und vor allem von den Arbeiter:innen, oder einfach aus der Notwendigkeit heraus, auch hier nach „kapitalistischer“ Logik zu produzieren, um auf dem Weltmarkt nicht unterzugehen. Dementsprechend können wir heute nicht bei der Idee eines sozialistischen Staates stehen bleiben, der die Aufgabe übernimmt, die Ressourcen im Einklang mit anderen gesellschaftlichen Bereichen besser zu verteilen. Denn damit laufen wir Gefahr, wieder bei der staatlich gelenkten Warenproduktion des Staatssozialismus zu landen – vor allem dann, wenn eine sozialistische Gesellschaft nur neben und in Konkurrenz zum globalen Kapitalismus entsteht. Vielmehr müssen wir planwirtschaftliche Ansätze weiterentwickeln, die uns einer wirklich direkten und damit demokratischen Kontrolle der Produktion so nahe wie möglich bringen – damit die Arbeitsteilung zwischen „Wissenschaft, Öffentlichkeit und Industrie“ immer weniger von einem gesonderten Staatsapparat geleistet wird.